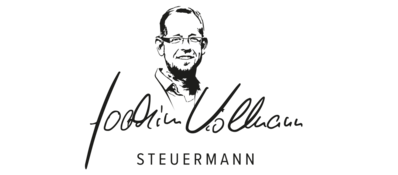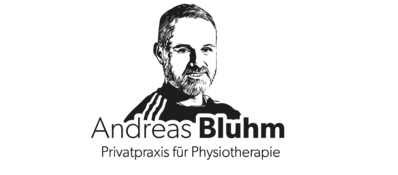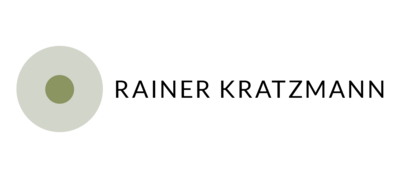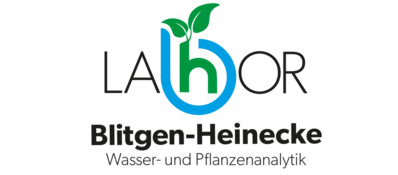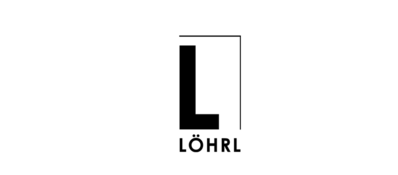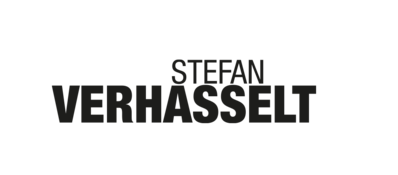Ein Tag am Niederrhein: Einstürzende Altbauten – St. Maria Magdalena in Goch
In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1993 stürzte mit dem Kirchturm der Pfarrkirche St. Maria Magdalena eines der Wahrzeichen Gochs ein. Jan Jessen hat mit Zeitzeugen über dieses denkwürdige Ereignis gesprochen.
13. April 1992
Um 3.20 Uhr erschüttert ein Erdbeben die Niederrheinische Bucht. Mit einer Stärke von 5,9 auf der Richterskala geht es als „Jahrhundertbeben“ in die Geschichte ein. Das Epizentrum liegt zwar im niederländischen Roermond. Doch auch auf deutscher Seite werden Menschen aus dem Schlaf gerissen. In Goch, einer Kleinstadt nahe der Grenze, lösen sich durch die Erschütterung Steine und Mörtel aus dem Mauerwerk der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Die Schäden an dem 1323 geweihten Gotteshaus, dessen fünfgeschossiger, fast siebzig Meter hoher gotischer Turm eines der Wahrzeichen der Stadt ist, sind schnell behoben.
Dechant Johannes Baptist Ludes, der seit 1970 Pfarrer der Gemeinde ist, misst dem Zwischenfall keine große Bedeutung zu. Er hat ganz andere Sorgen. Das Glockengeläut hoch oben im Turm macht Probleme, seit 1961 fünf Glocken installiert wurden. 1982 hatte ein Gutachter festgestellt, dass der Turm zu sehr in Schwingungen geriet, wenn die Glocken geläutet wurden. Immer wieder war es zu Rissen in den Mauern gekommen, die notdürftig geflickt werden mussten. Zwei Jahre später musste deshalb der Holzstuhl, in dem die Glocken befestigt waren, gegen ein Stahlgerüst ausgetauscht werden. Außerdem wurde eine massive, schwere Gegenpendelanlage eingebaut. Drei Monate vor dem Erdbeben hat allerdings ein Experte gewarnt, dass die Maßnahme bei weitem nicht ausreicht. Die neuen Stahlträger stünden unter so großer Dehn- und Zugkraft, dass „dem das alte Mauerwerk auf Dauer nicht standhalten kann“. Eine Warnung, die ungehört verhallt. Schließlich laufen da ja noch die umfangreichen Restaurierungsarbeiten. Das Gotteshaus hat neue Fenster und eine neue Orgel bekommen, der Chor ist umgestaltet worden. Ab Sommer soll das Hauptschiff trockengelegt und nach historischem Vorbild ausgemalt werden. Ein Mammutprojekt.
24. Mai 1993
Es ist Nacht in Goch. Eine laue, warme Frühlingsnacht. In der Kleinstadt herrscht Ruhe. Am Abend zuvor hat die Gemeinde in Maria Magdalena eine Messe gefeiert. Dutzende Gläubige sind da gewesen, auf der Orgelempore hat ein 35-köpfiger Chor gesungen, begleitet von Organist Rudolf Koppers. Die fünf Glocken haben lange Zeit geläutet. Dechant Ludes kann ruhig schlafen. Die Restaurierungsarbeiten in seiner Kirche sind fast vollständig abgeschlossen, das Gerüst im Inneren soll in den nächsten Tagen abgebaut werden. Doch in der Kirche, oben im Turm arbeitet es. Unbemerkt, leise. Noch. Was keiner weiß: Das Mauerwerk wird nur noch durch einen Anker gehalten, die Mauerwerksfestigkeit ist gleich Null.
Um 2.27 Uhr wird der Druck auf das Metall zu groß. Mit einem trockenen Knall bricht der Nordanker, ein Mauerwerksbrocken aus der Nord-Ost-Ecke bricht aus, schlägt durch das Kirchendach in den Boden des Gebäudes. Der Hauptträger des Glockenstuhls verliert seinen Halt. Der gesamte Glockenstuhl rauscht in die Tiefe und reißt den Turm mit sich. So wird der Ablauf der Katastrophe einige Monate später in einem vom Münsteraner Generalvikariat in Auftrag gegebenen Gutachten skizziert werden.
In der oberen Etage des Pfarrhauses wird Renate Schmidt von dem Knall und dem anschließenden Rumoren geweckt. Die 40-jährige ist seit 1976 die Haushälterin des Pastors. „Um Gottes Willen, schon wieder ein Erdbeben“, denkt sie schlaftrunken, als sie merkt, wie der Boden ihres Zimmers vibriert. Einige Meter Luftlinie entfernt wird Cilly Tebuckhorst von der Fleischerei an der Adolf-Kolping-Straße von dem Gepolter wach. Sie weckt ihren Mann Theo, fragt ihn, was los sei. Er schaut nach draußen, sieht nur graue Wolken. „Nichts, es ist neblig“, grummelt er. Auch Gerd Thyssen von der Brückenstraße sieht, nachdem er aus dem Schlaf gerissen worden und auf den Balkon seiner Wohnung gegangen ist, nur Nebel und legt sich wieder ins Bett. Thyssen ist Leiter der Zentralrendantur, der Kirchenverwaltung.
Renate Schmidt sieht den vermeintlichen Nebel auch, als sie nach draußen blickt. „Da ist jemand in die Kirche reingefahren“, denkt sie. Und dann fällt ihr auf, dass etwas fehlt. Der Kirchturm ist weg. Einfach nicht mehr da. Eilig macht sie sich auf den Weg nach unten, zum Pastor. Sie weckt ihn. „Es ist etwas ganz Furchtbares passiert.“ Er müsse jetzt ganz, ganz stark sein, sagt sie ihm. Ludes zieht sich seinen Morgenmantel an. Die beiden gehen nach draußen, in die riesige Staubwolke hinein. Draußen stehen schon zwei Polizisten. „Mein Gott, Herr Dechant, Sie leben ja!“, ruft einer der beiden Männer dem Pastor zu. Ludes hört das kaum. Seine Kirche sieht es aus, wie nach einem Bombenangriff. Wo einst der Kirchturm stand, ist jetzt ein meterhoher Berg aus geborstenen Steinen, bizarr verbogenen Stahlträgern, zersplittertem Holz. Der Pastor bricht in Tränen aus.
Dann ruft er Gerd Thyssen an. Der streift sich einen Trainingsanzug über, hastet nach draußen, kann nicht glauben, was er sieht. Der Kirchturm ist über das seitliche Marienschiff abgekippt, auf das Pfarrhaus, hat das Arbeitszimmer des Pastors zerstört. Ludes und Schmidt haben an ein Wunder grenzendes Glück gehabt. Das vier Meter hohe Kreuz ist nur wenige Meter neben dem Bett des Geistlichen in den Boden eingeschlagen, hat sich so tief in das Erdreich gegraben, dass nur vierzig Zentimeter von ihm zu sehen sind. In der Luft hängt der Geruch von Mörtelstaub, es herrscht eine gespenstische Stille. Mittlerweile hat sich vor dem Trümmerhaufen eine kleine Gruppe von Menschen versammelt. Der Pastor, seine Haushälterin, Thyssen, die beiden Polizisten, die die Unglücksstelle behelfsmäßig mit Flatterband absperren, Hausmeister Erich Busseck, der Organist Rudolf Koppers, der sich auf den Schreck einen Cognac und zwei Bier genehmigen muss. Sie alle rätseln, was wohl passiert ist, suchen nach den Trümmern eines Flugzeuges, das in den Turm gerast sein könnte, muss. Nichts. Renate Schmidt überredet die Männer dazu, das Allerheiligste aus der Kirche zu holen. Sie bringen es noch in der Nacht ins Pfarrheim. An Schlaf ist in dieser Nacht nicht mehr zu denken.
Das Ausmaß der Katastrophe wird deutlich, als die Sonne am Morgen über Goch aufgeht
Die riesige rote Staubwolke hat sich über Wiesen, Straßen, Häuser und Bäume in der Nachbarschaft gelegt. Die Trümmer des Turms liegen weit verstreut. Die Autos des Pastors und seiner Haushälterin sind zerstört. Schon um sieben Uhr verständigt Ludes Weihbischof Heinrich Janssen in Xanten. Gerd Thyssen ruft bei der Versicherung an. Um die Ruine wird ein Metallzaun errichtet, um sie abzusichern. Im Laufe des Tages kommen hunderte, wenn nicht tausende Menschen zu der Unglücksstelle. Viele weinen. Ältere Gocher, die sich noch an die grauenhafte Nacht erinnern können, als ihre Stadt Anfang Februar 1945 von alliierten Bombern in Schutt und Asche gelegt wurde, sagen, dass die Kirche damals nicht so zerstört war, wie heute. Pastor Ludes steht den ganzen Tag am Zaun, redet wie in Trance mit den Menschen, gibt Interviews. Das Fernsehen kommt natürlich auch, die Kleinstadt Goch bekommt ihre 15 Minuten Ruhm. Weltweit wird über die Katastrophe berichtet, sogar in Mexiko und Japan. Vergleichbar ist das, was in Goch passiert ist, nur mit dem Einsturz des Campanile auf dem Platz vor dem San-Marco-Dom in Venedig am 14. Juli 1902.
In die Erschütterung über den Einsturz des Gocher Wahrzeichens mischt sich an diesem Tag aber auch Erleichterung. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Turm bei der Vorabendmesse zusammengekracht wäre. Oder vierzehn Tage vorher, als am Weißen Sonntag zahlreiche Kinder in der Kirche ihre erste Kommunion erhielten.nErst gegen Abend an diesem denkwürdigen 24. Mai 1992 kommen die Beteiligten wieder etwas zur Ruhe. So richtig realisieren werden Pastor Ludes, Renate Schmidt, Gerd Thyssen und all die anderen, die der Kirche verbunden sind, aber erst in den kommenden Wochen, was da passiert ist. „Es ist, als ob ein lieber, vertrauter Mensch stirbt. Dafür braucht man lange, um das zu verarbeiten“, wird Renate Schmidt Jahre später zu Protokoll geben.
Die Ursache für den Einsturz des Kirchturms von St. Maria Magdalena konnte nie abschließend geklärt werden. Die Fachleute einigten sich darauf, dass es wohl ein Zusammenspiel vieler verschiedener Faktoren war: Das Fundament unter der Kirche, das von den mittelalterlichen Maurern nicht fachmännisch angelegt wurde. Der große Kirchenbrand von 1716, durch den der Mörtel, der die Steine zusammenhielt, brüchig wurde. Die Begradigung des Turms im Jahr 1906. Die Bombardierung im Februar 1945, die Sprengung der Mittelschiffsäule durch ein SS-Kommando wenige Tage später. Der Einbau der zusätzlichen Glocke im Jahr 1961 und der des stählernen Glockenturms im Jahr 1984. Die Absenkung des Grundwasserspiegels. Das Erdbeben von 1992.
In den Monaten nach der Katastrophe brach eine Welle der Hilfsbereitschaft über die Gemeinde hinein. Die katholischen Gottesdienste konnten im evangelischen Gotteshaus gefeiert werden. Die Bevölkerung führte zahllose Spendenaktionen für den Wiederaufbau des Turms durch, Spendenbriefe kamen sogar aus Neuseeland. Am 30. Oktober 1993 konnte die erste Messe nach dem Unglück in Maria Magdalena gefeiert werden, nachdem 3000 Kubikmeter Schutt abgefahren worden war. Am 24. Mai 2003, genau zehn Jahre nach dem Einsturz, zog ein Montagekran die neue Kirchturmspitze auf. Der neue Turm von Maria Magdalena ist ein schlichtes Bauwerk aus 16 Mauerwerkspfeilern, gestaltet vom Münsteraner Architekten Dieter Baumewerd. Nicht sonderlich geliebt in der Bevölkerung. Aber immerhin: ein Turm.
Text: Jan Jessen | NiederRhein Edition, Ausgabe Herbst/Winter 2008
Quellen: Wilhelm Joosten „Der Kirchturm St. Maria Magdalena, Goch (Eine Dokumentation)“, Martin Ahls, „Die Chronik. Bau, Einsturz und Wiederaufbau der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Goch“, Stadtarchiv Goch, eigene Recherchen