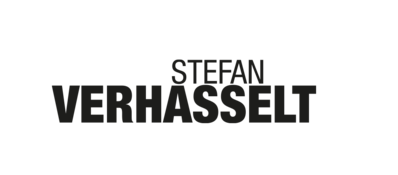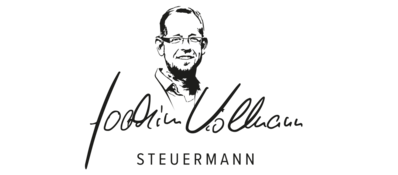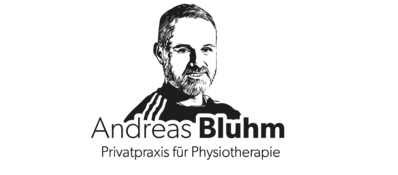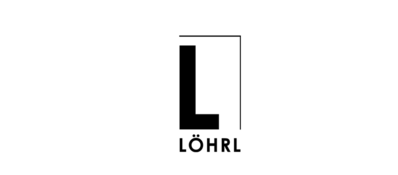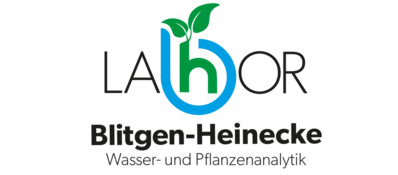Bereits Geschichtsschreiber Tacitus schrieb ausführlich über die Vetera Castra in seinen Werken. Belegt wurde die Existenz des Legionslagers Vetera Castra I auf dem Gelände des Xantener Fürstenbergs zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Archäologen Hans Lehner. Lehners langjährige Ausgrabungen (1905–1914 und 1925–1930) waren und sind auch deshalb bedeutsam für die provinzialrömische Archäologie des Rheinlands, geben sie doch Aufschluss darüber, dass auf dem Fürstenberg bei Xanten ab 10 n. Chr. tatsächlich eine der größten Militäranlagen im römischen Reich existierte. Zwei Legionen, also knapp 10.000 Soldaten, waren dort stationiert. Dass aber die das Lager umgebende Vorstadt, die sogenannte „canabae“, weitreichender war als gedacht, konnten die Archäologen des Landschaftsverbands-Rheinland (LVR) erst durch Funde bei Grabungen ab März 2023 nachweisen.
„In der Lagervorstadt befand sich die Zivilbevölkerung, die sich dort ansiedelte, um Handel zu treiben und die Versorgung der Soldaten zu gewährleisten. Dort lebten auch die Familien der Soldaten”, erklärt Dr. Julia Rücker. Sie betreut wissenschaftlich die Grabungsarbeiten im Lagerumfeld und hat sich mit uns in der Außenstelle Xanten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) getroffen und uns einen spannenden Einblick in ihre Arbeit gegeben.